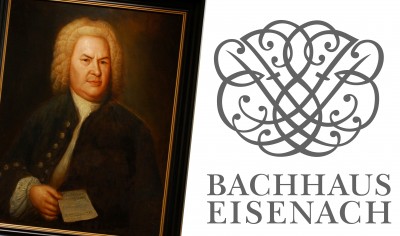Thüringer Orgelpositiv von ca. 1650 im Instrumentensaal. Foto: Constantin Beyer.
Instrumentensammlung
Das Bachhaus verfügt über eine Sammlung von fast 900 historischen Musikinstrumenten. Vier davon, darunter ein gebundenes Clavichord aus der Zeit um 1690, machte der Leipziger Sammler und Musikalienhändler Paul de Wit dem Bachhaus zur Eröffnung 1907 zum Geschenk. Bedeutenden Zuwachs erhielt der Bestand 1910 durch die Schenkung der 154 Instrumente umfassenden Sammlung von Aloys Obrist. 2024 folgte eine weitere bedeutende Schenkung von 468 historischen Blasinstrumenten durch den Sammler Günter Hett.
Der Instrumentensaal im historischen Bachhaus zeigt 29 barocke Instrumente, die Bach in seinen Werken einsetzte. Darunter sind z.B. ein thüringisches Orgelpositiv von 1650, ein Spinett von Johann Heinrich Silbermann (1765), eine siebensaitige Gambe (Leipzig 1725, gebaut von dem mit Bach befreundeten Instrumentenbauer Johann Christian Hoffmann), ein fünfsaitiges Violoncello piccolo (Nordböhmen, ca. 1750) und eine Viola d’amore mit sechs Spielsaiten und sechs Resonanzsaiten (Wien, um 1700). Jede Stunde gibt es ein kleines Konzert auf fünf historischen Tasteninstrumenten (im Eintrittspreis inbegriffen), getreu dem Motto des langjährigen Bachhaus-Direktors Conrad Freyse: „Im Bachhaus darf die Musik nicht schweigen“.
Der Marc-Aurel-Hett-Saal im Neubau erzählt anhand von 147 weiteren Instrumenten die Geschichte der Entwicklung der Blasinstrumente. Denn das technikbegeisterte 19. Jahrhundert hat nahezu alle bis dahin üblichen Musikinstrumente enorm verändert: die Blechblasinstrumente durch die Erfindung des Ventils, die Holzblasinstrumente durch raffinierte Klappensysteme, mit denen sich nun in jeder Tonart sauber spielen ließ. Neue Instrumente wie die Tuba oder das Saxophon traten hinzu, andere wie das Basshorn, die Ophikleide oder das Kornett waren nur zeitweise erfolgreich. Dieser Teil der Ausstellung befindet sich nicht im Rundgang, bei Interesse wird um Meldung am Tresen gebeten. Jeden Sonntag findet um 15 Uhr eine Führung durch den Saal statt (im Eintrittspreis inbegriffen).
Zahlreiche weitere Musikinstrumente wie etwa ein Thüringisches Cembalo von 1715, ein Cembalo von Jacob Hartmann (1765) oder ein Pedalclavichord von ca. 1815 befinden sich im Magazin, das begleiteten Studiengruppen nach Voranmeldung zugänglich gemacht werden kann.

Marc-Aurel-Hett-Saal im Neubau mit einer Ausstellung zur Geschichte der Blasinstrumente. Foto: André Nestler.